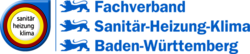Service
Innungen und Innungsfachbetriebe, die Unterstützung benötigen, finden beim Fachverband kompetente Ansprechpartner. Ein ganzes Team an Hauptamtlichen helfen zu den Geschäftszeiten weiter. In den Referaten Technik, Recht und Bildung, Betriebswirtschaft sowie Organisation und Verwaltung sitzen Experten, die telefonisch, per Mail, Brief und auch persönlich im Bedarfsfall mit Rat und Tat, zur Seite stehen. Außerhalb dieser Zeiträume, quasi rund um die Uhr, nutzen Innungen und Betriebe mithilfe spezifischer Online-Zugänge die im Downloadcenter zur Verfügung stehenden Informationen und Materialien.
Wie solche Unterstützungs- und Dienstleistungsangebote des Fachverbandes konkret aussehen, soll hier einmal dargestellt werden. Anhand von Best-Practice-Beispielen zeigen die Referate auf, in welchen Situationen sie passende Lösungen finden konnten, um die Interessen einzelner Mitglieder zu wahren.
Technik und Umweltschutz
Der Stellenwert des Referats Technik bei den Mitgliedsbetrieben ist außerordentlich hoch – schließlich leistet es in sämtlichen Bereichen wertvolle Unterstützung. Was jedoch viele Betriebe nicht wissen: Bevor neue Verordnungen oder Normen überhaupt bekannt werden, haben die Techniker des Fachverbands auf allen Ebenen – häufig sogar Jahre im Voraus – bereits entscheidende Vorarbeit geleistet.
Das Gesetzgebungsverfahren rund um das GEG im Jahr 2023 hat deutlich gemacht, dass die Bundesverwaltung auf Tempo setzt – bis heute. So blieb damals immerhin das Osterwochenende, um einen GEG-Entwurf zu lesen, mit der geltenden Fassung zu vergleichen, sich mit Dritten auszutauschen und eine fundierte Stellungnahme zu erarbeiten. An dieser Vorgehensweise hat sich seither kaum etwas geändert. Trotz mehrfacher Hinweise an die verantwortlichen Ministerien, diese Praxis zu überdenken, bleiben regelmäßig nur wenige Tage Zeit, um umfangreiche Dokumente mit teils mehreren Hundert Seiten zu prüfen und zu kommentieren. Das führt zu einem anhaltend hohen Arbeits- und Zeitdruck in der Verbandsarbeit.
Sobald die Rahmenbedingungen feststehen, ist es Aufgabe der Fachverbandsexperten, die neuen Informationen schnell und verständlich für die Betriebe aufzubereiten – etwa durch Fort- und Weiterbildungsangebote, Musterschreiben oder praxisgerechte Checklisten.
Und sollte es trotz aller Vorarbeit zu Problemen in der Umsetzung kommen, stehen die Betriebsinhaber nicht allein da: Sie erhalten rasch und unkompliziert Rat und Unterstützung.

Gesetze, Verordnungen und technisches Regelwerk
Novelle Gebäudeenergiegesetz
Das novellierte Gebäudeenergiegesetz trat zum 1. Januar 2024 bis auf zwei Ausnahmen in Kraft. Die Gesetzesnovelle wurde vom Fachverband intensiv begleitet und für die Mitgliedsbetriebe im Rundschreiben, Newslettern usw. aufbereitet. Parallel dazu wurde eine ausführliche Erläuterung zum neuen GEG erstellt und laufend aktualisiert. Auf der FV-Homepage wurde ein neuer Bereich „Aktuelles zum neuen GEG“ erstellt, in dem alle relevanten Informationen zum GEG übersichtlich zusammengefasst wurden. Die „Unternehmererklärung“ wurde auf die neuen Anforderungen angepasst und mehrere Webinare durchgeführt.
Bundesförderung für effiziente Gebäude
Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wurde zum 1. Januar 2024 neu gefasst. Über die Änderungen wurden die Mitgliedsbetriebe im Rundschreiben und Newsletter umfangreich informiert. Auf der FV-Homepage wurde ein neuer Bereich „Aktuelles zur neuen Heizungsförderung“ erstellt, in dem alle relevanten Informationen zur Heizungsförderung übersichtlich zusammengefasst wurden. Damit stehen den Mitgliedern alle notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Zusätzlich wurden Webinare organisiert und durchgeführt. Über den ZVSHK und ZDH wurden offenen Fragestellungen aus der Betriebsberatung mit einer Kommentierung zur Klärung an das BMWK gesandt. Dabei konnten wesentlichen Vereinfachungen für das Nachweisverfahren erreicht werden.
Kommunale Wärmepläne
Nach dem Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg mussten alle 104 Stadtkreise und Große Kreisstädte in Baden-Württemberg bis zum 31.12.2023 einen „Kommunalen Wärmeplan“ (KWP) erstellen. Da die KWP erhebliche Auswirkungen auf die zukünftige Wärmeversorgung der Gebäude haben werden, hat sich der Fachverband intensiv mit den Konsequenzen der KWP beschäftigt. Dazu wurden verschiedene KWP im Hinblick auf die Konsequenzen für die SHK-Branche ausgewertet. Für die eigene Homepage „www.waermeplanung-bw.de“ wurde eine umfangreiche FAQ-Liste erstellt sowie alle veröffentlichten Wärmepläne in Baden-Württemberg zusammengetragen.
Die Bibel des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks: TROL 2022

Quelle: ZVSHK
Die Arbeit endet nie. Verschiedene Fragestellungen aus der Praxis, aber auch Novellierungen anderer Vorschriften, wie z. B. der DIN 18896 „Feuerstätten für feste Brennstoffe - Technische Regeln für die Installation“, haben die Projektgruppe veranlasst, das Kapitel 5 „Verbrennungsluftversorgung“ der TROL zu überarbeiten. Ziel der Projektgruppe ist es, einen Gleichklang mit den anderen Vorschriften zu erreichen. Außerdem sollen Unstimmigkeiten zwischen der TROL und dem DVGW-Arbeitsblatt G 600 (TRGI) ausgeräumt werden. Auch wollte man erreichen, das komplette Berechnungsverfahren in die TROL zu integrieren, ohne dass andere Vorschriften parallel hinzugezogen werden müssen – sozusagen alles aus einer Hand. An dieser Stelle vielen Dank an den DVGW für die Freigabe der Grafik bzw. Tabellen aus der TRGI für die Verbrennungsluft, sodass diese in die TROL übernommen werden können. Da es doch einige Details zu besprechen und abzustimmen galt, wurde man im Jahr 2024 nicht ganz fertig und nimmt die Arbeiten dazu im Jahr 2025 wieder auf.
Da das Regelwerk für handwerklich erstellte Einzelraumfeuerungsanlagen, wie zum Beispiel Grundöfen, Heizkamine oder Hypokausten, die Grundlagen für deren Bau stellt, ist die TROL 2022 die Pflichtlektüre, die jeder Ofen- und Luftheizungsbaubetrieb kennen sollte. Selbstverständlich darf sie auch nicht in dessen Vorschriftensammlung fehlen. Denn letztendlich formuliert sie auch vertragliche Eigenschaften, die beim Bau von Einzelraumfeuerungsanlagen in ihrem Geltungsbereich zu beachten sind.
Wasserversorgung und -entsorgung

Trinkwasserhygiene
Das SHK-Handwerk kümmert sich um die Wasserversorgung und -entsorgung, wobei die Trinkwasserhygiene mit dem Thema Legionellen eine besondere Bedeutung bekommen hat. Eine gefragte Maßnahme ist die Qualifikation zum "SHK-Fachbetrieb für Hygiene und Schutz des Trinkwassers". Diese Fortbildung vermittelt umfassendes Wissen zur Trinkwasserhygiene in Planung, Bau und Betrieb von Trinkwasseranlagen. Sie befähigt Betriebe auch, Risikobewertungen durchzuführen, die nach einem positiven Legionellenbefund erforderlich sind.
Betreiber sollen beraten und motiviert werden, eine fundierte Risikobewertung durchführen zu lassen. Verbraucher und Eigentümer müssen über Maßnahmen informiert werden, um hygienische Risiken zu beseitigen oder zu verringern.
Um dies zu erreichen, hat die SHK-Berufsorganisation mit dem Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) und der Bundesvereinigung der Firmen im Gas- und Wasserfach e.V. (figawa) die Schulungsinitiative „Fit für Trinkwasser“ ins Leben gerufen. Weitere Informationen finden sich im Bereich Service.
Gefahrstoffe
Überwachungsgemeinschaft (ÜWG)
Die Landesstelle der Überwachungsgemeinschaft Technische Anlagen der SHK-Handwerke e.V. (ÜWG) beim Fachverband ermöglicht Betrieben das rechtlich abgesicherte Arbeiten an Heizölanlagen. Die ÜWG ist eine Güte- und Überwachungsgemeinschaft gemäß der Verordnung zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Sie zertifiziert die von ihr überwachten Betriebe nach Paragraf 62 AwSV, wodurch diese an den genannten Anlagen arbeiten dürfen.
Die Landesstelle der ÜWG übernimmt folgende Aufgaben:
- Sie schult die betrieblich verantwortlichen Personen, damit diese die erforderliche Sachkunde nachweisen können.
- Sie führt alle zwei Jahre mit Unterstützung von Fachprüfern die erforderliche Betriebsprüfung durch.
- Sie verleiht die Zertifizierung und verlängert diese bei Bestehen der Prüfung um jeweils zwei Jahre.
- Sie organisiert die vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen für die betrieblich verantwortlichen Personen.
- Sie berät die Fachbetriebe zu technischen und organisatorischen Fragestellungen.
- Sie bietet Schulungen zur Auffrischung der Kenntnisse im Heizölbereich für Monteure an.
Die Fortbildungsmaßnahmen und Monteurschulungen haben sich inzwischen erfolgreich als Onlineschulungen etabliert.
Novelle Gefahrstoffverordnung – Neue Vorgaben für den Umgang mit asbesthaltigen Materialien
Am 17. Juni 2024 wurde seitens des BMAS ein neuer Referentenentwurf zur Novellierung der Gefahrstoffverordnung veröffentlicht. Bereits 2022 wurde ein Versuch gemacht, die Gefahrstoffverordnung zu novellieren. Der damals veröffentlichte Entwurf verlief sich im Sande. Nach Jahren des Asbestdialogs sowie unzähligen Stellungnahmen zum Entwurf 2022 wurden seitens des verantwortlichen Ministeriums die Vorschläge der Beteiligten (oder besser betroffenen Kreise weitestgehend ignoriert).
Das hehre Ziel Bürokratie abzubauen und klarere Regelungen für alle Betroffenen zu schaffen wurde weit verfehlt.
Der Entwurf legt die komplette Verantwortung in die Hände von Planern und Handwerk. Der Bauherr bzw. Gebäudebesitzer kann seine Hände in Unschuld waschen. Das dadurch deutlich mehr Rechtsunsicherheiten für Planende, Handwerk, ja alle am Bau Schaffenden und nicht zuletzt den Auftraggeber bzw. Bauherrn selbst entstehen, ließ man seitens der Verantwortlichen einfach außer Acht. Auch, dass dadurch das finanzielle Risiko für den Auftraggeber bzw. Hausbesitzer deutlich steigt, zählte bei der Ausformulierung des Entwurfs 2024 offensichtlich nicht.
Zwar sind die Grundforderungen, wie z. B. die Verpflichtung des Unternehmers eine Gefährdungsanalyse zu erstellen oder bei Verdacht eine Vor-Ort-Probe zu entnehmen und analysieren zu lassen, nicht neu, aber durch die angedachte Neuregelung steigt die Rechtsunsicherheit in allen Handwerksbereichen, die in Bestandsgebäuden vor Oktober 1993 tätig werden wollen.
Leider war, wie so häufig in den letzten Jahren, viel zu wenig Zeit um sich für eine fundierte Stellungnahme mit dem Entwurf detailliert zu befassen und sich mit anderen abzustimmen. Nichtsdestotrotz hat der Fachverband eine Stellungnahme abgegeben. Am 5. Dezember 2024 war es dann so weit und die Novelle der Gefahrstoffverordnung ist in Kraft getreten. Leider hat sich nicht mehr allzu viel geändert in Bezug auf den Entwurf und die geforderten Punkte in unserer Stellungnahme wurden nicht berücksichtigt.
Betriebsberatung unterstützt Mitgliedsbetrieb bei Klärung zur Mehrfachbelegung eines Schornsteins
Ein Mitgliedsbetrieb wurde von einem Kunden beauftragt, in einem Reihenhaus einen defekten Niedertemperatur-Kessel (NT-Kessel) durch einen neuen zu ersetzen. Der vorhandene NT-Kessel war über eine gemeinsame Abgasanlage (Schornstein) an ein bestehendes System angeschlossen, das zusätzlich eine Einzelfeuerstätte (Kachelofen) umfasst. Es handelt sich somit um eine sogenannte Mehrfachbelegung der Abgasanlage.
Der SHK-Fachbetrieb wies den Kunden darauf hin, dass eine solche Mehrfachbelegung im Zuge des Einbaus eines neuen Heizkessels nicht mehr zulässig sei. Stattdessen schlug der Fachbetrieb vor, einen neuen außenliegenden Edelstahlrohrkamin zu errichten, um die aktuellen technischen und rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Im Zuge der Umsetzung ergaben sich von verschiedenen Parteien unterschiedliche Aussagen, ob die Mehrfachbelegung weiterhin zulässig ist oder nicht. Der Mitgliedsbetrieb wandte sich daraufhin an den Fachverband mit der Bitte um rechtliche und technische Einordnung.
Die Spezialisten des Fachverbands konnten dem Betrieb auf Grundlage geltender Vorschriften wie folgt weiterhelfen:
1. Ökodesign-Richtlinie lässt NT-Kessel im EFH nicht mehr zu
Gemäß der Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG dürfen in neu eingebauten Heizsystemen in Einfamilienhäusern nur noch Geräte mit einem jahresbedingten Raumheizungs-Nutzungsgrad von mindestens 86 % eingesetzt werden. Dieser Mindestwert wird von herkömmlichen NT-Kesseln nicht mehr erreicht. Zulässig sind daher nur noch moderne Brennwertgeräte.
2. Brennwerttechnik schließt Mehrfachbelegung aus sicherheitstechnischen Gründen aus
Da moderne Brennwertgeräte im Gegensatz zu NT-Kesseln mit Überdruck in der Abgasleitung arbeiten, besteht bei einer gemeinsamen Nutzung mit einem weiteren, im Unterdruck arbeitenden Wärmeerzeuger (wie z. B. einem Kachelofen) die Gefahr, dass Abgase durch die zweite Anlage in den Aufstellraum gelangen – insbesondere dann, wenn der Kachelofen nicht in Betrieb ist. Dies stellt ein erhebliches sicherheitstechnisches Risiko dar und ist somit unzulässig. Weiter müsste die nicht feuchtebeständige Abgasanlage sowieso umgebaut werden, da in Verbindung mit dem Einsatz eines Brennwertgerätes die Abgasanlage feuchtebeständig sein muss.
Daraus ergibt sich, dass eine Mehrfachbelegung mit einem Brennwertgerät grundsätzlich nicht zulässig ist.
3. Alternative Lösung: Neuer Edelstahlrohrkamin für Brennwertgerät
Der Vorschlag des Mitgliedsbetriebs, das neue Brennwertgerät über eine separate, feuchteunempfindliche Abgasleitung nach außen zu führen (z. B. als außenliegender Edelstahlkamin), entspricht der aktuellen technischen Regel (TRGI) und den Vorgaben der Feuerungsverordnung (FeuVO). Gleichzeitig bleibt der vorhandene Kamin samt Kachelofen weiterhin unter Bestandsschutz und muss nicht an die geänderten Ableitbedingungen nach § 19 der 1. BImSchV angepasst werden.
Mit Unterstützung des Fachverbands konnte der SHK-Fachbetrieb seine rechtliche und technische Einschätzung gegenüber dem Kunden bekräftigen. Die Beratung trug maßgeblich dazu bei, dem Kunden eine sichere und regelkonforme Lösung aufzuzeigen und etwaige Fehleinschätzungen aus dem Weg zu räumen.
Arbeitshilfen

Als Arbeitshilfen gibt der Fachverband Kommentare, FAQ, Musterformulare und vieles mehr heraus, die regelmäßig überarbeitet werden, wie zum Beispiel eine neue Unternehmererklärung nach § 60 GEG oder FAQs rund um die neue BEG. Sämtliche Informationen und Materialien stehen den Innungsfachbetrieben anschließend rund um die Uhr im auf der Fachverbands Homepage zur Verfügung. Hier finden Innungen, Betriebe und Ehrenamtsträger nach dem Einloggen Arbeitshilfen, Leitfäden, Kommentare, Musterschreiben und Protokolle.
Eine wichtige Arbeitshilfe war beispielsweise das Anschreiben für Kunden, das vor dem Hintergrund des Scheiterns der Ampel-Koalition die Nachfrage nach Angeboten anregen sollte. Zum Jahreswechsel 2024/25 wurde das Schreiben mehrfach an die neue Situation angepasst.